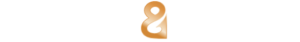Dass am Grund der Ostsee noch erhebliche Mengen an Munition aus dem Zweiten Weltkrieg rosten, ist bekannt. Dass aber auch in manchen Binnengewässern noch Kampfmittel liegen, wissen die wenigsten. Dr. Johann Müller klärt darüber auf und analysiert das Gefahren-Potenzial für Angler.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden große Mengen an Munition in Nord- und Ostsee entsorgt. Diese Altlasten bereiten den zuständigen Behörden zunehmend Sorgen, denn eine Freisetzung giftiger Bestandteile ist anzunehmen. Doch auch in Binnengewässer wurde oftmals Munition versenkt. Beispielsweise gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als deutsche Truppen bei Rückzugsgefechten den Gegnern ihre Kampfmittel nicht überlassen wollten. Bei den niedrigen Wasserständen der vergangenen Jahre kamen in deutschen Flüssen und Seen häufig Kampfmittel zum Vorschein, die dann auch geborgen wurden. Über das Ausmaß der Belastung von Binnengewässern ist jedoch wenig bekannt.
Laut Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven wurden in deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee nach dem Zweiten Weltkrieg circa 1,6 Millionen Tonnen Munition versenkt. Die Munitionshüllen korrodieren, sodass umweltschädliche Stoffe ins Meer gelangen können. Etwa 80 Jahre nach den ersten Versenkungen lässt das Bundesministerium für Bildung und Forschung durch den Projektverbund CONMAR die Lage und Beschaffenheit von solchen Munitionsaltlasten deutscher Küstengewässer genauer untersuchen, um mögliche Effekte der Altlasten auf die Umwelt zu erforschen; Binnengewässer sind nicht in die Untersuchungen einbezogen.
Für Flüsse und Seen ist die Datenlage zur Munitionsbelastung ungenau, da die offenbar häufig praktizierten Versenkungen mit in der Regel geringeren Mengen am Rande von Kriegshandlungen vorgenommen und nicht dokumentiert wurden. Zwar hat sich das Umweltbundesamt in den 1990er Jahren mit Rüstungsaltlasten in Deutschland intensiv beschäftigt, diese Arbeiten aber 2003 eingestellt und die entsprechenden Datenbanken an die für militärische Altlasten zuständigen Bundesländer übergeben.
Fallbeispiel Seitenkanal Gleesen-Papenburg
Eine Sondierung und Bergung erfolgte beispielsweise im Zeitraum 1985/86 vor der Erweiterung des Hafens in der Gemeinde Dörpen am nach Kriegsausbruch nicht mehr fertiggestellten Seitenkanal Gleesen-Papenburg. Der wird als Abzweig vom Küstenkanal lediglich wenige Hundert Meter als Wasserstraße genutzt. Hier hatten im April 1945 schwere Kämpfe zwischen deutschen Soldaten und anrückenden alliierten Truppen stattgefunden. Dabei sollen die sich nach und nach zurückziehenden deutschen Einheiten Teile ihrer Munition im Kanal versenkt haben.
Aus den Unterlagen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ems-Nordsee geht hervor, dass Taucher hier in einem 27 Meter langen Teilabschnitt über 60 Spreng- und Panzergranaten und drei Panzerfäuste bargen, zudem Gewehrgranaten und Maschinengewehrmunition. Danach galt der Hafenbereich als geräumt. Die südlich angrenzenden Kanalabschnitte jedoch nicht, weil hier bei Testsondierungen ebenfalls Munition gefunden worden war. Für diesen Kanalbereich wurde über eine Länge von etwa drei Kilometern ein Angel- und Badeverbot erlassen, das bis heute Gültigkeit hat. Allerdings geht auch aus den Unterlagen des Amtes hervor, dass der Gewässerboden stark mit Schlamm bedeckt ist. Besonders an einem Kanalabschnitt mit einer Einleitung eines größeren Entwässerungsgrabens wurden bereits im Jahre 1990 Schlammeintreibungen bis zu einer Mächtigkeit von drei Metern festgestellt. Eine Entmunitionierung wäre ohne eine kostenaufwendige Schlammbeseitigung gar nicht möglich, wurde daraus gefolgert.
Wenn jedoch keine akute Gefahr für die Bevölkerung besteht beziehungsweise kein konkreter Fundort benannt werden kann, wird oftmals auf eine Kampfmittelbeseitigung verzichtet. Gegebenenfalls treten dann Fragen zur möglichen Umweltbelastung in den Vordergrund, für die als oberste Landeseinrichtung in der Regel das Umweltministerium beziehungsweise eine nachgeordnete Behörde zuständig ist, beispielsweise in Bayern das Landesamt für Umwelt.
Brandenburg besonders mit Munition belastet
Mengenmäßig dürfte die Munitionsbelastung der Landschaft jedoch in Brandenburg deutlich höher sein als in anderen Bundesländern. Hier verblieben Blindgänger der Angriffe bei der Eroberung Berlins ebenso wie Kampfmittel der alliierten Truppen und der Wehrmacht in Böden und Gewässern zurück. Hinzu kommen Rückstände auf den ehemaligen Militäranlagen der Kaiser- und Nazizeit sowie der Sowjet-Besatzung und der Nationalen Volksarmee der DDR.
Laut Angaben des Ministeriums des Innern und für Kommunales in Potsdam stehen im Land Brandenburg circa 585.000 ha der Fläche des Landes unter Kampfmittelverdacht. Lokale Schwerpunkte sind neben Oranienburg auch Potsdam, die Oder-Neiße-Linie und der Bereich südlich Berlins. Die dem Kampfmittelbeseitigungsdienst vorliegenden historischen Erkenntnisse über örtliche Vorkommen sind in eine sogenannte Kampfmittelverdachtsflächenkarte eingetragen, die auch Gewässerfundstellen enthält. Bekannte Gefahrenbereiche müssen von den jeweiligen Eigentümern oder der örtlichen Ordnungsbehörde grundsätzlich durch Hinweisschilder gekennzeichnet beziehungsweise mit Zutrittsbeschränkungen belegt werden.
Völlig anders als in Brandenburg war das Kriegsgeschehen dagegen in Schleswig-Holstein. Hier ergaben sich viele Städte kampflos den britischen Truppen, wobei sich die deutschen Soldaten jedoch häufig ihrer Waffen entledigten, indem sie diese in Gewässer entsorgten. Laut Landeskriminalamt handelt es sich um Ausrüstung, Waffen und Munition, die vornehmlich von einzelnen Soldaten weggeschmissen wurden. Neben typischen Waffen waren darunter auch Nebelkörper oder andere Arten von militärischer Pyrotechnik. Größere Truppenverbände entsorgten zudem patronierte Munition von Flakverbänden, hier vor allem Munition der Kaliber 2,0 bis zu 10,5 Zentimeter.
Später versenkten dann auch die britischen Besatzungstruppen Munition in den Binnengewässern. Auch in diesen Fällen handelt es sich überwiegend um Handwaffenmunition sowie Hand- und Mörsergranaten. Die verklappten Mengen wurden nicht dokumentiert. Allerdings sind aus größeren Seen mehrere Tonnen an Kampfmitteln geborgen worden, womit eine Orientierung zum Umfang des Umweltproblems möglich wird.
Kaum Probleme hat man dagegen offenbar mit Weltkriegsmunition in den bayerischen Binnengewässern. Das Landesamt für Umwelt teilt mit, dass keine Erkenntnisse dazu vorliegen, ob in Binnengewässern in Bayern während des Zweiten Weltkrieges Munition versenkt wurde.
Gefahren für Gewässer und Fische
80 Jahre nach ihrer Versenkung ist grundsätzlich davon auszugehen, dass von Weltkriegsmunition in Gewässern schädliche Stoffe ausgehen und sich auf die Unterwasserwelt auswirken. Eine Freisetzung von Schadstoffen in den schleswig-holsteinischen Binnengewässern wird vom Landeskriminalamt in Kiel in naher Zukunft allerdings nicht erwartet. Diese Einschätzung beruhe darauf, dass es sich überwiegend um Kampfmittel mit einem geringen Sprengstoffanteil und mit großen Wandstärken (Stahl) handele, die sehr langsam korrodieren und derzeit noch keine Giftstoffe als Abbauprodukte des Sprengstoffes freisetzten, so das LKA.
Die Einschätzung des LKA in Schleswig-Holstein mag für Munition mit großen Wandstärken gelten, kann aber nicht generell angenommen werden. Zur Betrachtung der Wirkungen von Munition oder deren Abbauprodukte auf Fische müssen allerdings Untersuchungen aus Meeresgebieten herangezogen werden, da für Binnengewässer keine Informationen vorliegen.
In der Zeitschrift „Wissenschaft erleben“ des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, Ausgabe 2018/2, berichten Mitarbeiter des eigenen Instituts für Fischereiökologie unter dem Titel „Zeitbomben im Meer“ über die Wirkung von TNT auf Fische. Für die Untersuchungen wurde das Munitionsversenkungsgebiet Kolberger Heide in der Ostsee vor Kiel ausgewählt, da vorliegende Ergebnisse zeigten, dass sich in diesem Gebiet bereits zahlreiche Substanzen aus der Munition im Sediment und Wasser großflächig verbreitet hatten und in vielen bodenlebenden Arten und experimentell exponierten Miesmuscheln Sprengstoffe nachgewiesen werden konnten.
Als geeignete Indikator-Fischart wurde die dort heimische und standorttreue Kliesche (Limanda limanda) ausgewählt. Ein Plattfisch, der am Meeresboden lebt und dadurch den Sprengstoffen stark ausgesetzt ist. Die Laboruntersuchungen zeigten bei 25 Prozent der Klieschen Lebertumore auf, während die Tumorrate bei Klieschen aus unbelasteten Gebieten nur bei knapp fünf Prozent lag. Weitere Laborversuche zeigten, dass Abbauprodukte von TNT das Erbgut von Fischen schädigen können, womit eine mögliche Erklärung für die gehäufte Tumorrate im Versenkungsgebiet vorliegt.
Somit ist also nachgewiesen, dass gefährliche Substanzen aus Munition in Gewässern auch in die Nahrungskette der Fische gelangen können. Andererseits haben die Forscher jedoch auch festgestellt, dass Sprengstoff-typische Verbindungen (STV) in der Leber von Fischen verändert und über die Gallenflüssigkeit und den Darm ausgeschieden werden können. Eine Anreicherung in Fischen wie etwa bei Schwermetallen ist durch STV folglich eher unwahrscheinlich.
Bei den angefragten Ländereinrichtungen zum Verbraucherschutz sind keine Informationen über die Belastung von Süßwasserfischen aus Gewässern mit möglicher Munitionsbelastung bekannt. Somit verbleiben lediglich die Erkenntnisse von den Fischen im Meerwasser zu einer orientierenden Einschätzung. Dr. Jörn Scharsack vom Arbeitsbereich Meeresumwelt des Thünen-Institut für Fischereiökologie würde die Ergebnisse zu STV und marinen Fischen allerdings nicht direkt auf Süßwasserfische übertragen. Hierzu sollten gesonderte Untersuchungen durchgeführt werden. Dabei könnte schrittweise vorgegangen werden, indem bei Verdachtsfällen zunächst Wasserproben aus verschiedenen Tiefen und Sedimentproben chemisch auf STV untersucht würden. Wenn dabei STV gefunden werden, sollte man nach seiner Ansicht auch Fische untersuchen, wobei neben den Organen auch Filets von Speisefischen einbezogen werden könnten. Hier wären allerdings bei erfolgreicher Entgiftung über den Verdauungstrakt nur geringe STV-Konzentrationen zu erwarten.
Risiken durch Munition für Angler eher gering einzustufen
Theoretisch können Angler auf verschiedene Weise mit Munition in Berührung kommen. Allerdings sind die meisten Munitionsarten nicht mit Oberflächen versehen, in die sich Angelhaken festsetzen würden. So ist es nicht verwunderlich, dass bei den eigenen Recherchen keine Fälle von Munition am Haken gefunden wurden. Sollte dies doch einmal der Fall sein, wären Angler im Boot wohl eher gefährdet als am Ufer, wo in der Regel eine Rückzugsmöglichkeit besteht.
Mit an Land geschwemmter Munition könnten Angler bei der Herrichtung ihres Platzes, beispielsweise beim Setzen von Rutenhaltern, in Berührung kommen. Allerdings wäre die Gefährdung hier ähnlich wie bei anderen naturinteressierten Personen, die ebenso im Uferbereich nach für sie interessanten Pflanzen und Tieren suchen. Generelle Einschränkungen – wie an ganzen Gewässerabschnitten – ließen sich damit kaum rechtfertigen. Insbesondere nicht bei solchen mit relativ gleichbleibendem Wasserstand, wie beispielsweise Flüsse und Kanäle mit geregeltem Pegelniveau. Die Gefahren erscheinen auch bei den Länderbehörden nicht real in Erwägung gezogen zu werden. Und falls doch Kampfmittel im Wasser anzunehmen sind, müssen diese Stellen beispielsweise in Brandenburg mit Warnhinweisen versehen werden, die in der Regel auch als Verbote für Angler anzusehen sind.
Bezieht man die Rechercheergebnisse auf den Seitenkanal Gleesen-Papenburg, so erscheint das bestehende Angelverbot nicht nachvollziehbar. Hier darf davon ausgegangen werden, dass mögliche Kampfstoffe so stark mit Sediment bedeckt sind, dass Fischfanggeräte, egal ob einfache Haken, Köder oder Reusen, nicht mit ihnen in Kontakt kommen. Eine Gefahr für Angler kann somit weitgehend ausgeschlossen werden. Diese Meinung teilt auch Hermann Poppen, Amtsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Ems-Nordsee. Doch die WSA-Akten enthalten ein Angelverbot aus dem Jahre 1985, das 1989 noch einmal bestätigt wurde. Eine Aufhebung dieses Verbots sieht die Bundesbehörde zurzeit (leider) nicht vor.