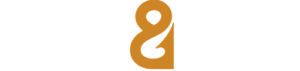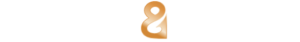In den Tiefen des Weddellmeers leben artenreiche Lebensgemeinschaften. Dieser antarktische Meeresbereich soll bei fortschreitendem Klimawandel als potenzielles Refugium für eisabhängige Algen und Tiere dienen.
Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) koordiniert elf Institutionen, die im neuen EU-Projekt WOBEC systematische Langzeitbeobachtungen möglicher Veränderungen dieses einzigartigen Ökosystems vorbereiten sollen. Das Projekt erhält rund 1,9 Millionen Euro Förderung.
Millionen von Eisfischen
Das Weddellmeer ist das größte Randmeer des Südlichen Ozeans in der Antarktis und ein Hotspot des Lebens. Kaiserpinguine und Robben bekommen hier ihren Nachwuchs. Krillschwärme, die Mikroalgen unter den Eisschollen abweiden, locken Fische, Wale und Seevögel an. Am Meeresboden brüten Millionen von Eisfischen und Unterwassergärten aus Glasschwämmen, Nesseltieren und Seescheiden erreichen stellenweise einen ähnlich hohen Artenreichtum wie tropische Riffe.
Elf Institutionen aus acht Ländern haben sich zum Weddell Sea Observatory of Biodiversity and Ecosystem Change (WOBEC) zusammengeschlossen. In den kommenden drei Jahren werden die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den aktuellen Status der Artengemeinschaft im Weddellmeer bestimmen, als Referenz für eine langfristige Beobachtung des Ökosystems in einer sich wandelnden Antarktis.
Drastischer Rückgang des Meereises
„Im Weddellmeer existiert ein weitestgehend unberührter und damit besonders schützenswerter Naturraum. Dieser hat nicht nur einen hohen ästhetischen Wert, sondern beherbergt einzigartige Lebensvielfalt. Diese biologische Vielfalt ermöglicht auch wichtige Ökosystem-Dienstleistungen, etwa das Speichern von Kohlenstoff in der Tiefsee durch absinkende Eisalgen und Planktonreste“, erklärt Dr. Hauke Flores, Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut und Koordinator des EU-Projekts. „Aber der Klimawandel ist längst auch in der Südpolarregion angekommen: In den letzten Jahren haben wir einen unerwartet drastischen Rückgang des Meereises beobachtet. Wir wissen nicht, ob und wie sich die dortigen Bewohner an die veränderten Umweltbedingungen anpassen werden. Um das beurteilen zu können, müssen wir zunächst den Ist-Zustand des Ökosystems besser kennen und dringend anfangen, systematisch Daten zu erheben.“
Der Fokus des Projekts liegt auf der Beobachtung möglicher langfristiger Veränderungen der Biodiversität im östlichen Weddellmeer. Nationen wie Deutschland, Norwegen und Südafrika forschen seit Jahrzehnten in dieser Region, aber es fehlt an systematischen Studien des riesigen Ökosystems. Hier klafft eine große Lücke: Östlich wie westlich des Studiengebiets von WOBEC gebe es für tausende Kilometer keine Langzeitbeobachtungen der marinen Artenvielfalt, so Hauke Flores.
Für das Jahr 2026 ist unter der Leitung der Universität Rostock eine Expedition mit dem Eisbrecher Polarstern entlang des Null-Meridians und bis ins südliche Weddellmeer geplant. Auf der Reise wollen die Forschenden unter anderem den Maud-Rise-Seeberg erkunden und an frühere Untersuchungen der benthischen Artengemeinschaften am Kap Norwegia westlich der deutschen Neumayer-Station III anknüpfen.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden nicht nur neue Daten sammeln, sondern auch ihre Archive durchforsten und bislang nicht veröffentlichte oder schwer zugängliche Ergebnisse in öffentlichen Datenbanken für die Allgemeinheit nutzbar machen. „Auf der Grundlage historischer wie aktueller Daten wollen wir eine Strategie für langfristige Umweltbeobachtungen im Weddellmeer mithilfe von autonomen Observatorien, Satellitenfernerkundung und schiffsbasierten Messungen erarbeiten“, sagt Hauke Flores.
Meeresschutzgebiet gefordert
Die EU und andere CCAMLR-Mitglieder (Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis) setzen sich seit langem dafür ein, große Teile des Weddellmeers unter Schutz zu stellen. Mit der Expertise des AWI wurde ein Schutzkonzept erarbeitet und 2016 erstmals bei der CCAMLR eingereicht. „Das vorgeschlagene Meeresschutzgebiet umfasst aktuell zwei Regionen im westlichen und im östlichen Weddellmeer, die zum Teil im Studiengebiet von WOBEC liegen“, erklärt Dr. Katharina Teschke, Meeresökologin und Leiterin des Schutzgebiet-Projekts am AWI. Das geplante Meeresschutzgebiet verfolgt einen Ansatz, der das gesamte Ökosystem in den Blick nimmt und auf dem Vorsorgeprinzip beruht. „Es geht darum, eine bislang unberührte Meeresregion als Refugium für kälteliebende Arten zu erhalten, wo sie sich bei anhaltender Erwärmung der Erde ungestört an die veränderten Umweltbedingungen anpassen können“, sagt Katharina Teschke.
„Bislang scheiterte der Antrag für das vorgeschlagene Meeresschutzgebiet an der geforderten Einstimmigkeit, und die derzeitige geopolitische Lage erschwert die Verhandlungen von CCAMLR. Hoffnung macht jedoch die Verabschiedung des Abkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt in Gebieten jenseits der nationalen Gerichtsbarkeit (BBNJ Treaty) im vergangenen Jahr“, so Katharina Teschke. „Es ist ein positives Signal, das vielleicht hilft, den Prozess der Ausweisung eines Schutzgebiets im Weddellmeer unter CCAMLR zu stimulieren. WOBEC bietet die Chance, auf wissenschaftlicher Basis bereits jetzt eine Strategie für die Erfassung der Biodiversität und ihrer zukünftigen Veränderungen im Bereich des Meeresschutzgebietes zu entwickeln.“
-Pressemitteilung Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung-