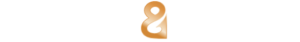Regenwürmer spielen eine zentrale Rolle für intakte Böden: Sie verbessern die Bodenstruktur, reichern den Boden mit nährstoffreichem Wurmhumus mit wichtigen Nährstoffen an und tragen dazu bei, Mikroorganismen im Boden zu verbreiten, die ebenfalls für die Fruchtbarkeit entscheidend sind.
„Die Aktivität von Regenwürmern fördert also gesunde Böden – die Grundlage für eine ertragreiche und nachhaltige Landwirtschaft“, erklärt Dr. Andrey Zaytsev vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz und fährt fort: „Gleichzeitig kann die moderne landwirtschaftliche Bewirtschaftung Regenwürmer erheblich gefährden. Der Einsatz von chemischen Pestiziden, Herbiziden und Düngemitteln sowie eine intensive Bodenbearbeitung machen den Tieren zu schaffen. Diese Faktoren können zu einem Rückgang der Regenwurmpopulationen führen, was langfristig die Bodenfruchtbarkeit und die ökologische Stabilität gefährdet.“
Zaitsev hat gemeinsam mit Dr. Bibiana Betancur-Corredor sowie Dr. David J. Russell mit einer Meta-Analyse die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung auf die biologische Vielfalt von Regenwürmern untersucht. Die Fachleute verglichen ungestörte Ökosysteme – Grünland und Primärwald – mit verschiedenen landwirtschaftlich genutzten Flächen. „Wir haben hierfür Daten aus 113 Veröffentlichungen und 44 Ländern analysiert und konnten so 1040 Vergleiche zur Regenwurmdichte und -biomasse sowie 536 Vergleiche zur Regenwurmvielfalt ziehen“, fügt Betancur-Corredor hinzu. Das Team untersuchte zudem, wie sehr die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung auf die Tiere von den in den Studien angegebenen Boden-, Klima- und Bewirtschaftungspraktiken abhängen.
Deutlich weniger Regenwürmer auf intensiv genutztem Ackerland
Die Ergebnisse zeigen, dass die Regewurmdichte auf Ackerland 18 Prozent, die Biomasse 15 Prozent und der Artenreichtum sogar 27 Prozent geringer ist als auf ungestörten Standorten. „Unsere Meta-Analyse belegt die tiefgreifenden Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung auf Regenwurmpopulationen in verschiedenen Agrarökosystemen. Die nachteiligen Auswirkungen, die auf Ackerflächen mit intensiver Bewirtschaftung beobachtet wurden, unterstreichen die Anfälligkeit der Regenwurmpopulationen für externe Störungen“, erläutert Zaytsev. Bestimmte landwirtschaftliche Nutzungsformen, wie die Agroforstwirtschaft und die Nutzung von Brachflächen in Kombination mit einem geringeren Einsatz von Chemikalien, haben jedoch das Potenzial, diese negativen Auswirkungen zu mildern, heißt es in der Studie. Regionen mit kontinentalem Klima, das durch kühle Sommer gekennzeichnet ist, weisen zudem günstigere Ergebnisse für Regenwurmpopulationen auf, während eine übermäßige Bodenverdichtung und ein geringer Gehalt an organischer Substanz die negativen Auswirkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung noch verstärken.
„Um die Vielfalt der Regenwürmer und die Funktionen des Ökosystems Boden zu schützen, sollten bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung die regionalen Klimaschwankungen und Bodeneigenschaften berücksichtigt werden. Die Erhaltung der Regenwurmpopulationen ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Landwirtschaft – die Tiere spielen eine wichtige Rolle für die Gesundheit des Bodens und die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems. Durch die Umsetzung ganzheitlicher Ansätze können wir die negativen Auswirkungen abmildern und die Erhaltung der Regenwurmvielfalt in Agrarlandschaften fördern. Hiervon profitieren alle – die Regenwürmer, die Böden und die Landwirtschaft“, schließt Zaytsev.
-Pressemitteilung Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung-